Drei Kurzgeschichten über Amerika
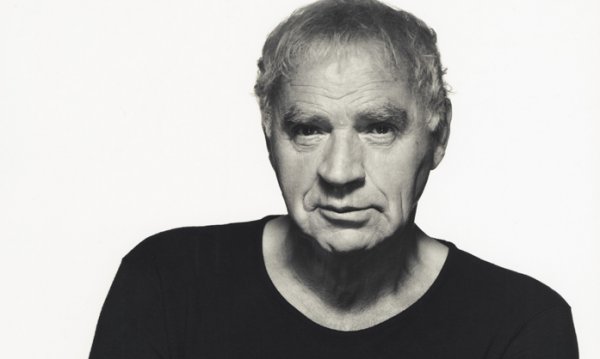
N.Y.C.
Ein Jahr nach meiner Ankunft in Amerika stellte ich mich in eine Schlange, um ermäßigte Karten für den Broadway zu kaufen. Ich war ein wenig verwundert, auf den Plakaten nicht die Namen der großen amerikanischen Dramatiker zu erblicken. Doch ich tröstete mich damit, dass die Welt voranschritt und das Theater mit ihr. Nachdem ich mir mit gebührendem Respekt etwa ein Dutzend Stücke angesehen hatte, sagte ich mir, die Amerikaner wüssten sicherlich, was sie da tun, doch für den Moment sei der Broadway einfach nichts für mich, und ich begann, Kontakte zum Off-Theater zu suchen. Ich verschickte Kopien der enthusiastischen Londoner Rezensionen und den Text von Aschenkinder an verschiedene Agenten und Produzenten. Und das war der Anfang.
Ich habe eine Lieblingsszene in Dostojewskis Doppelgänger, in der der Titularrat Goljadkin Höllenqualen der Erniedrigung erleidet, während er sich überlegt, ob er sich durch die Küche auf einen Empfang schleichen soll, zu dem man ihn vorn nicht einlassen will. In etwa so sahen meine Tage in New York während der ersten paar Jahre aus. Als ich den New Yorkern mein Leid klagte, wussten sie gar nicht, wovon ich redete. Sicher, es ist nicht leicht, überall Gedränge, und man muss um jeden Preis reinkommen. Wenn sie dich zur Tür rausschmeißen, kommst du durchs Fenster wieder rein. Wenn du drin bist, hast du gewonnen. Also versuchte ich reinzukommen.
Eine Woche, nachdem ich mein Stück und die Rezensionen abgeschickt hatte, rief ich bei den Produzenten an. Die Sekretärinnen baten mich, meinen Namen zu buchstabieren, also buchstabierte ich: G-L-O-W-A ... usw. "Okay, der Chef ruft Sie gleich zurück," versicherten sie mir. Ich wartete eine Stunde, zwei, drei, und hatte Angst, auf die Toilette zu gehen. Und nachdem ich so zwei, drei Tage gewartet hatte, denn ich wollte nicht aufdringlich erscheinen, rief ich erneut an. Das Gespräch war das gleiche: "Buchstabieren Sie bitte ... er ruft Sie gleich zurück". Und wieder wartete ich vor dem Telefon, hungrig, weil ich vor Angst, etwas zu verpassen, nicht mehr vor die Tür ging.
Ich wusste, dass all diese Theater, Verlagshäuser und Filmstudios irgendwo ganz in der Nähe waren, aber das half mir auch nichts. Und durch das Fenster dröhnte erbarmungslos der Samba, denn das obere Ende von Manhattan ist stark puerto-ricanisch geprägt.
In dieser Zeit klingelte bei mir ständig das Telefon. Meist waren es polnische Künstler, vor allem Maler und Grafiker, die mir von ihren New Yorker Erfolgen erzählten, und ich erzählte ihnen von meinen. Welch außerordentliches Glück sie hätten, mich anzutreffen, wo ich doch von früh bis spät mit Agenten und Produzenten verhandelte. Dass meine Aschenkinder in einem erstklassigen Theater aufgeführt werden sollten. Und sie erzählten mir von ihrer geplanten Ausstellung im Museum of Modern Art. Und dass jemand ihre Bilder kaufen wolle, aber nur alle auf einmal, und sie seien noch am Überlegen, ob sie verkaufen sollten, wo doch nach der Ausstellung und den hervorragenden Rezensionen klar sei, dass sie im Preis steigen würden. Ich riet ihnen, nicht zu verkaufen, und sie rieten mir, vorsichtig zu sein und mir im Vertrag ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Regisseurs und der Schauspieler vorzubehalten. Ich versprach ihnen, hart zu bleiben, und sie versprachen mir, nicht zu verkaufen. Und dann warteten wir weiter.
Selbstverständlich glaubten wir einander nicht einen Moment lang, doch irgendwie hoben diese Gespräche unsere Stimmung. Denn es ist nicht leicht, sich zu einer Niederlage zu bekennen und dazu, dass einen niemand will. Aber übertreiben wir nicht, ich konnte jederzeit mit meinem restlichen Geld ein Ticket kaufen, mich in ein Flugzeug setzen und zurückkehren. Die Volksrepublik Polen war schließlich nicht die Sowjetunion, und ich war nicht Adam Michnik, so arg würde man mir schon nicht zusetzen. Doch die ganze Zeit über erschienen in der "Trybuna Ludu" und anderen gleichgearteten Zeitungen Artikel, dass das Mitgefühl der Welt mit uns schon bald zur Neige gehe, genau wie unsere Stipendien – bis dahin hatte ich bis auf die dreihundert von Jerzy Giedroyc nichts erhalten – und wir würden zurückkehren "wie die Kraniche", schrieb Frau Dozentin Krzywobłocka in der Zeitschrift "Walka Młodych". Zurückkehren unter Bitten und Flehen.
Nebenbei hätte ich mit einer Rückkehr auch jenen meiner Bekannten eine Freude gemacht, die mitleidig mit den Achseln gezuckt und sich an ihren Café-Tischen gefragt hatten – und solche Worte schaffen es immer irgendwie über den Ozean –, was solche Nullen wie Olbiński und Dudziński, Czeczot oder Głowacki in Amerika zu suchen haben. Und auch jenen Kritikern, die beschlossen hatten, ich könne nichts anderes, als über die polnische Bananenjugend zu schreiben. Und die es mir nun verübelten, dass ich das bittere polnische Brot gegen das leichte amerikanische eingetauscht hatte. Aus solcherlei deprimierend niedrigen Beweggründen hatte ich beschlossen zu bleiben und auszuhalten, in der stillen Hoffnung, irgendein Moralist möge der Versuchung erliegen, mir zu folgen, und versuchen, dieses leichte Brot zu kauen. Obgleich ich befürchtete, dass es Moralisten hier besser ergehen könnte, denn schon Dostojewski schrieb einst, er habe noch keinen Moralisten getroffen, dem es schlecht gegangen sei.
Die letzten paar Sätze stammen aus einem Tagebuch, das ich gegen Ende des Jahres 1983 führte, als ich ebenso verbittert wie enttäuscht war. Doch im nächsten Moment wurde ich unterbrochen, weil der Maler Jan Sawka mich anrief, man habe ihm eine Ausstellung im Guggenheim-Museum angeboten, und ich erwiderte ihm, ich hätte dem "New Yorker" eine Erzählung vorgelegt, und Norman Mailer habe sie voller Begeisterung gelesen. Wir legten die Hörer auf, lachten beide Tränen über unsere Lügengeschichten und warteten weiter.
In Wirklichkeit habe ich niemals ein Tagebuch geführt, sondern schreibe alles jetzt, während ich schreibe. So wie jeder ernst zu nehmende Schriftsteller, der schwört, er gebe seine Tagebücher unbearbeitet heraus. Es sei denn, er stirbt plötzlich und unerwartet, so wie viele Jahre später mein armer Kollege Krzysztof Mętrak, dessen Aufzeichnungen tatsächlich unverändert erschienen. Da standen dann Sachen drin, bei denen mir fast die Augen rausfielen. Denn wir hatten ja gemeinsam Jagd auf den Regisseur Poręba, den Schauspieler Filipski und andere verwirrte Nationalisten gemacht. Doch während all dieser Jahre unserer näheren Bekanntschaft hatte es in seinen Texten nie auch nur einen Hauch von Abneigung gegen Personen gegeben, die nicht gänzlich mit dem polnischen Volk verbunden waren – wie man sich in der Volksrepublik Polen oft ausdrückte, um das unangenehme Wort "Jude" zu vermeiden.
Dies wiederum erinnert mich daran, dass der erste russische Schriftsteller, den ich persönlich in der Bar des Hotels Bristol kennenlernte, der für den Leninpreis nominierte Georgi Gulia war. Dieser offenbarte mir augenblicklich, dass er sich sehr für die polnische Literatur interessiere, insbesondere für die Frage, welcher Schriftsteller Jude sei und welcher nur schwul.
"Brandys zum Beispiel", sagte er, "der ist Jude".
"Nein", desinformierte ich ihn, "der ist schwul".
Er wunderte sich, fragte jedoch weiter:
"Und Andrzejewski, der ist schwul?"
"Nein, der ist Jude", log ich weiter. Der nominierte Schriftsteller sah mich misstrauisch an, doch schon nach dem nächsten Wodka fasste er wieder Vertrauen zu mir, wurde melancholisch und bat mich, ihm beim Kauf von Präservativen behilflich zu sein.
"Für mich und für meine Partnerin, denn die Präservative bei uns in Moskau sind hart wie LKW-Reifen."
In diesem Moment hielt ich es für möglich, dass er vielleicht doch Schriftsteller war.
Die Sache mit Norman Mailer wiederum war selbstverständlich eine Lüge, aber doch nicht ganz. Denn eines Tages hatte ich mir ein Herz gefasst und mich mit der englischen Übersetzung einer meiner Erzählungen auf den Weg zum "New Yorker" gemacht, dessen Redaktion eine Etage eines mittleren Hochhauses an der dreiundvierzigsten Straße, ganz in der Nähe des Broadways, ausfüllt. Als ich mich gerade im Parterre umblickte, welchen Aufzug ich nehmen sollte, entdeckte ich Mailer, erriet, woher er kam, und ging auf ihn zu, um ihn zu fragen. Ich sagte:
"Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir vielleicht …" Doch an dieser Stelle unterbrach er mich auch schon: "Aber gerne doch" – und signierte das Manuskript, das ich in den Händen hielt.
GREENPOINT
Wie ist das nun mit diesem Provinzkomplex, der mir in Amerika so zu schaffen machte? Oder mit dem Minderwertigkeitskomplex, den jeder oder zumindest fast jeder Pole mit nach New York bringt.
Denn es ist ja nicht nur, dass man aus einem zivilisatorisch rückständigen, armen Land kommt, das jahrelang unterdrückt und misshandelt wurde. Oder dass man schlecht Englisch spricht. Manche sprechen auch gut Englisch, und es hilft nichts. Vielleicht die Kleidung? Die Art sich zu bewegen? Die Bestellung im Restaurant? Eine besondere Denkweise? Oder vielleicht die Tatsache, dass uns Rechtschaffenheit im Allgemeinen eher belustigt? Dass wir nichts, aber auch gar nichts darauf geben, was uns die Politiker hier erzählen? Dass wir Vertrauen für eine Dummheit halten? Und schon verwandelt sich unser Minderwertigkeitskomplex in ein Gefühl der Überlegenheit. Dass nämlich die hier rein gar nichts von der Welt wissen, weil sie zu wenig auf den Arsch gekriegt haben. Auf jeden Fall werden Polen in New York augenblicklich noch polnischer, als sie es in Polen waren.
Der polnische Teil von Brooklyn namens Greenpoint erinnert stark an die Stadt Koluszki, und Koluszki wiederum wird in New York noch mehr zu Koluszki als in der Umgebung von Lodz. Das Brooklyner Koluszki hat etwas zutiefst Erschreckendes, aber auch Rührendes an sich. Diese Scharen von alten, erschöpften Frauen, die sich die Seele aus dem Leib schuften, um ein paar Dollar nach Polen zu schicken. Die alte Frau Stasia zum Beispiel, von der Kent Avenue in der Nähe der Greenpoint Avenue, die mir mit Tränen der Rührung in den Augen einen Brief von ihrer Tochter in Kielce zeigte. "Liebe Mutti. Wir haben uns alle große Sorgen gemacht, als wir hörten, dass du krank bist. Aber bitte komm noch nicht zurück, denn erstens haben wir deine Wohnung vermietet und zweitens brauchen wir unbedingt noch dreißigtausend Dollar. Deine Enkelinnen Jadzia und Stasia fragen ständig nach ihrer Oma, und sie wachsen so schnell, dass du sie, wenn du in drei, vier Jahren zurückkommst, nicht wiedererkennen wirst. Möge Gott dir noch viel Gesundheit und Kraft zum Arbeiten schenken. Deine dich vermissende Tochter Zosia, dein Schwiegersohn Zenek und deine dich liebenden Enkelinnen Jadzia und Stasia."
In Amerika arbeitet man sehr hart. In Greenpoint arbeitet man bis zur Erschöpfung. Die meisten arbeiten schwarz und verdienen folglich weniger. Sie kommen auf unterschiedliche Weise ins Land, manche legal, das heißt, indem sie jemanden bestechen, der angeblich Kontakte zur Botschaft hat, andere illegal. Vor Kurzem öffneten amerikanische Zollbeamte einen aus Kanada kommenden Viehtransporter. Auf den Kühen in den letzten Reihen saßen Polen mit ihren Koffern in den Händen.
Jene, die angekommen sind, sprechen schon bald von ihrer Rückkehr. Aber von hier wegzukommen ist noch schwerer als einzureisen. Verlobte, Ehemänner und vor allem Kinder verzichten nur ungern auf ihre Geldmaschinen. Nur dass die verdienten Dollars früher mehr wert waren, man arbeitete hart, aber kehrte doch als großer Herr und Mann von Welt nach Hause zurück. Heute kann man von Glück sagen, wenn einem die Ehefrau, die Verlobte oder der Ehemann zu Hause treu bleibt …
Am härtesten arbeiten die Frauen. Sowohl die jungen als auch die alten putzen acht Stunden die eine Wohnung und gehen dann zur nächsten. Denn Putzen ist die Spezialität der polnischen Frauen auf dem New Yorker Arbeitsmarkt. Für gewöhnlich werden sie von wohlhabenden Juden beschäftigt, denn man weiß ja, dass die aus dem Osten viel sorgfältiger arbeiten als die aus Puerto Rico. Für die Polinnen hat das eine gute Seite, weil es in jüdischen Familien immer jemanden gibt, der Polnisch spricht, sodass man sich verständigen kann, aber auch eine unangenehme, weil sie einem ständig von Jedwabne erzählen oder einem einzureden versuchen, dass die Muttergottes eine Jüdin war.
Und nachts kann man noch etwas dazuverdienen, indem man in Restaurantküchen Pierogi faltet. Man schläft nicht viel, dafür aber billig – die Sparsamsten von ihnen zu acht in einem Zimmer, das mit auf dem Boden liegenden Matratzen möbliert ist. Das Geld senden sie ihren Ehemännern, denn die schreiben ihnen: "Wenn ich schon eine Frau in Amerika habe, dann muss man mir das auch ansehen können." Also schicken sie Päckchen um Päckchen und Dollar aufs Konto.
Dann bekommen die Frauen Briefe von zu Hause, dass ihr Mann sich amüsiert, und die Männer, dass ihre Frau herumhurt, also beißen sich die einen wie die anderen auf die Lippen und nehmen noch einen Job an. Nur dass irgendwann der Tag kommt, an dem man es nicht mehr aushält, und dann hören die Männer auf, Wohnungen zu renovieren, und verschleudern in einer Woche alles, was sie in fünf Jahren verdient haben. Man weiß ja, Polen verstehen zu feiern, der Smirnoff fließt in Strömen, und dann besuchen sie die Frauen auf den Matratzen, die jüngeren von ihnen, die es auch nicht mehr aushalten und die Trost und Mitgefühl bei den Männern suchen. Nur dass es sich zu zweit oder zu dritt auf einer Matratze nicht besonders gut schläft, vor allem weil die älteren Mitbewohnerinnen neben einem den Neid kriegen und anfangen zu sticheln. Und aufstehen muss man um sechs, damit man pünktlich in Manhattan ist. Nur am Sonntag kann man etwas länger schlafen, bevor der Gottesdienst beginnt.
Alle wissen, dass etwas falsch läuft, dass sie zu viel arbeiten und zu wenig verdienen, dass die Amerikaner sie auslachen, dass sie ein Englisch sprechen, das niemand versteht. Um sich herum sehen sie unfassbaren Reichtum. Sie wissen, dass irgendjemand schuld sein muss, aber sie wissen nicht wer, also beschuldigen sie sämtliche Ehemänner, Ehefrauen und Kinder und außerdem noch Bürgermeister Bloomberg, Präsident Kwaśniewski, Adam Michnik, George Bush, Jan Kulczyk und Colin Powell.
Selbstverständlich herrscht in Greenpoint eine strenge Hierarchie. Es gibt die alteingesessenen Emigranten, die einst für hundert Dollar Häuser gekauft haben, die heute eine halbe Million wert sind, es gibt die Besitzer der Restaurants und Liquor Stores, es gibt die Direktoren der Polish & Slavic Federal Credit Union und des Polish & Slavic Centre. Es gibt das Fernsehstudio, das die Nachrichten des Senders Polsat zeigt. Und es gibt die Banken. Vor einiger Zeit ging eine Bank bankrott, bei der die meisten Polen ihr Geld angelegt hatten, denn der Besitzer war ein Landsmann und er bot die höchsten Zinsen. Niemand hatte nach einer Einlagensicherung gefragt, und es gab auch keine. Dafür gab es mehrere Selbstmorde. Eine alte Frau, die die Ersparnisse ihres gesamten Lebens verloren hatte, zog in den Park. Einige folgten ihr. Die anderen resignierten und nahmen zusätzliche Jobs an, um die Verluste wieder reinzuholen. Und begannen noch fieberhafter nach Menschen zu suchen, die noch schlechter dran waren als sie selbst. Als sich schließlich der elfte September ereignete, erklärten die Polen in Greenpoint unverzüglich einen solidarischen Boykott der arabischen Zigaretten- und Zeitungsläden. Und als der polnische Sänger Kazik einen Gastauftritt in New York hatte, machte der Chef der örtlichen Skinheads namens Piwnica vor dem Konzert die folgende Ansage: "Das hier ist ein polnisches Konzert, und Juden gehen besser freiwillig." Tja, und einige gingen tatsächlich.
Wirklich schön ist es in Greenpoint nur am vierten Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. Dann machen sich die Polen gemeinsam mit den von ihnen verachteten Puerto-Ricanern auf den Weg zum East River, weil man von dort den besten Blick auf das Feuerwerk hat. Und dann sieht endlich alles so aus, wie es sein sollte.
EINE ZU GROSSE STADT
Polen wissen alles über New York aus Filmen und von Postkarten, aber das ist so ein Wissen wie über die Mona Lisa. Man weiß, dass sie lächelt, aber man weiß nicht warum und was ihr Lächeln bedeuten soll. Im Übrigen lächelt New York nach dem elften September 2001 und dem Verlust zweier Vorderzähne, wenn überhaupt, dann längst nicht mehr so breit. Joseph Brodsky schrieb, dass der Mensch, als er diese Stadt baute, etwas schuf, das sich vollständig seiner Kontrolle entzog. Isaac Bashevis Singer antwortete auf die Frage nach New York mit einem einzigen Wort: Hektik.
New York ist zu groß. Zu groß für seine ständigen Bewohner und erst recht für die Emigranten, die jeden Tag zu Hunderten aus ihren Jumbojets auf den J.F.K. Airport strömen. Man verhört sie behutsam, fotografiert sie, nimmt ihre Fingerabdrücke, lässt sie durch, schickt sie zurück oder verhaftet sie. Und die, die man durchlässt, gehen gleich darauf verloren. Manchmal hört man noch etwas von ihnen, dass sie etwas entdeckt oder gemalt, geschrieben oder einen Film gedreht haben. Oder dass sie jemanden umgebracht haben oder selbst erschossen wurden. Aber für gewöhnlich lösen sie sich einfach auf.
New York hat wenig Ähnlichkeit mit dem Rest von Amerika und sein Zentrum ebenso wenig mit dem Rest der Stadt. Manhattan hat etwas von einer mittelalterlichen Burg, die durch ein System von Brücken und Tunneln mit ihren Vorsiedlungen verbunden ist. Die U-Bahn, das heißt die Subway, also eine Art Verdauungstrakt, befördert tagtäglich Arbeitskräfte und Güter aus Queens, Brooklyn, Staten Island, der Bronx und New Jersey – das zwar als eigener Bundesstaat gilt, aber nur eine Flussbreite entfernt ist. Jeden Tag werden über dreieinhalb Millionen Menschen in diese Subway gestopft.
Als ich nach New York kam, wusste ich selbstverständlich, genau wie alle anderen, dass dies ein Asphaltdschungel war, und ich sagte mir frei nach Sinatra, dass, wenn ich es hier schaffte, ich es überall auf der Welt schaffen würde. Ich wusste in etwa, dass dies die Hauptstadt der Welt war, dass irgendwo ganz in der Nähe all diese Sport- und Filmstars wohnten, dass es CBS, ABC, die großen Verlagshäuser und die "New York Times" gab. Nur machte all das für mich zu Beginn überhaupt keinen Unterschied. Noch weniger ergibt sich aus einem solchen Wissen für polnische Putzfrauen, arabische Zeitungsverkäufer und koreanische Gemüsehändler. Oder für die Tausende von Chinesen oder Mexikanern, die die Kosten für ihre Einschleusung aus Peking oder Mexico City in schweißgetränkten, fensterlosen Nähfabriken oder in wie auch immer getarnten Bordellen abarbeiten.
New York macht sich gut auf den Briefen, die man nach Hause schreibt. Noch besser, wenn in diesen Briefen auch etwas Geld ist.
Doch wenn man ankommt, ist es erst einmal das Wichtigste, ein eigenes Plätzchen, sein eigenes Stückchen Stadt zu finden. Danach kann man langsam anfangen, sich umzuschauen. Und dann kann vielleicht sogar etwas passieren, manchmal sogar etwas Gutes. Denn diese Stadt ist unberechenbar. Im Allgemeinen weiß man überall auf der Welt, wer es schaffen müsste und warum. Aber hier weiß man gar nichts. Sichere Sieger gehen vor die Hunde und Chancenlose kaufen sich Penthouses.
Als es so aussah, als sollte Kakerlakenjagd im nächsten Moment von Hollywood verfilmt werden, ließ die Produzentin mich jeden Tag von einer Limousine mit Chauffeur abholen. Manchmal fuhren wir auch zusammen, und sie führte Verhandlungen mit dem Regisseur Sidney Lumet und den Schauspielern Dianne Wiest und William Hurt. Einmal gab mir der Fahrer dieser Limousine, als er mich nach Hause fuhr, seine Visitenkarte und sagte: "Wenn aus dem Film was wird, kannst du mich buchen. Wenn nicht, ruf an, dann gebe ich dir einen Job."
Manhattan ist für sich allein schon zu groß und aus etwa einem Dutzend nicht zueinanderpassenden Teilen zusammengeflickt. Die Verbissenheit der Wall Street hat nichts gemein mit der Resignation des East Village oder der Bowery, Harlem nichts mit Tribeca und Little Italy nichts mit Chinatown. Eben noch Tiffany und Bloomingdale und ein Stück die Straße hinauf oder hinunter Stände mit geklauten Fahrrädern und stückweise Zigaretten.
Um hier zu überleben, muss man schnell herausfinden, wo und wie. Sich zumindest ein Grundwissen aneignen. Nicht zwangsläufig eine so tiefe Lebensweisheit, wie sie die alte Frau besaß, mit der ich im überfüllten Autobus der Linie 116 in Richtung Żoliborz fuhr. An der Haltestelle "ul. Miodowa" sagte der Fahrer, er fahre nicht weiter, weil sich irgendein Kerl mit Filzmütze auf die vordere Plattform gedrängt hatte, und die Türen würden nicht schließen. Also flehten alle den Mann an, er möge es doch gut sein lassen und aussteigen, aber der reagierte gar nicht, und es war offensichtlich, dass er nicht nachgeben würde. Und in diesem Moment kreischte die alte Frau von innen:
"Die Mütze! Schmeißt ihm die Mütze runter!"
Irgendjemand zog dem Mann die Mütze vom Kopf und warf sie auf den Gehweg, woraufhin der ohne ein Wort vom Bus sprang. Die Türen schlossen sich und der Bus fuhr los. Ich habe früher in Polen über solche Filzmützenträger, wie ich sie aus der sozialistischen Wirklichkeit und aus der Lektüre Gogols kannte, eine ganze Reihe von Erzählungen geschrieben. Der Stoff zum Beispiel, über einen armen Schlucker, der in einem Lagerhaus wohnt und viele Jahre lang versucht, sich das Geld für einen Anzug zusammenzusparen, in dem er um die Hand der Kioskverkäuferin Baśka Ohnehals anhalten möchte. Doch als er den Anzug schließlich kauft und das Glück ihm bereits winkt, sieht er, dass in der zugefrorenen Bucht ein Mädchen ertrinkt. Er verhält sich edler als der Held von Camus’ Der Fall, denn er rettet das Kind. Doch besser ergeht es ihm dadurch auch nicht, denn der Anzug ist in Fetzen und Baśka Ohnehals für ihn verloren.
Und auch Czesław Pałek, ein anderer meiner Helden, passt in gewissem Sinn zur Filzmütze, und Ufnal aus Ich kann nicht klagen und Kuba aus Die Unterhose, die Lotterie und das Schwein, der durch das wahnwitzige, verfallende Schloss eines amerikanischen Stardesigners irrt, eine metaphorische Welt, in der von ihren Eltern ausgesetzte Kinder Bomben unter startenden Flugzeugen anbringen.
Ich nahm also einen Schnellkurs in Sachen New York. Fast sofort erkannte ich, dass sich hier alles ändert, sobald man seine Adresse wechselt. Kneipen, Freunde, Geliebte, Geschäfte. Man kommt aus der Serie Sex in the City in die Stadt, von der Martin Scorsese erzählt. Aus dem New York, von dem die Filme Woody Allens handeln, in das aus den Raps von Jay-Z. Wie viele Menschen hier leben, ist auch nicht ganz klar. Die letzte Volkszählung ergab über acht Millionen, aber die Fragebögen konnte ausfüllen, wer wollte und wie er wollte. Millionen illegaler Einwanderer füllten sie gar nicht aus, weil sie Angst hatten entdeckt zu werden, und ich auch nicht, weil ich keine Lust hatte. Wie es mit der Hautfarbe aussieht, weiß man auch nicht so recht. Menschen mit dunkler oder sogar sehr dunkler Hautfarbe sahen beim Ausfüllen des Fragebogens keinen Grund, ihr Kreuz in die Rubrik "Schwarzer" zu setzen. Und die fortschrittlichsten Weißen trugen sich gerne als Afroamerikaner ein.
Jeder weiß, dass man hier nicht schläft, um keine Zeit zu verlieren. Denn die Stadt erzeugt eine ungeheure Energie, gute und schlechte, und manchen nützt sie und andere macht sie kaputt. Es gibt hier ein fürchterliches Gedränge – die Menschenmassen, die sich zur Lunchzeit durch Manhattan wälzen, bekommt man in Polen allenfalls während Protestkundgebungen vor dem Sejm zu sehen. Und wohl nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Singles. Arme und reiche, Männer und Frauen, die sich allabendlich an ihre Bartische setzen und warten. Vielleicht ist es gerade das Gedränge, das die New Yorker Einsamkeit so schmerzhaft macht.
Als ich vor Kurzem versuchte, eine Liste meiner sämtlichen Adressen nach meiner Ausreise aus Polen zu erstellen, kam ich hoffnungslos durcheinander. London ging gerade noch. Halb so wild, nur vier Wohnungen, das vom Theater bezahlte Holiday Inn einmal ausgenommen. Aber in New York wurde ich fürchterlich hin und her geschleudert. Vom untersten Ende Manhattans bis ganz nach oben und wieder zurück. Von der exklusiven Park Avenue bis nach Chinatown, von der eleganten Ecke Fünfte und Einundsechzigste Straße bis in die überaus verrufene, weil neben einem Obdachlosenheim gelegene, Ecke Hundertsiebte Straße und Amsterdam Avenue. Dort wurden mir zweimal die Fenstergitter durchgesägt. Beim ersten Mal klaute man mir einen Schwarz-Weiß-Fernseher, den ich eine Woche zuvor auf der Straße gefunden hatte, und beim zweiten Mal – einen Schal.
Dann wieder die Downtown Eastside, Ecke Vierte Straße und Avenue B, in der übel beleumdeten sogenannten Alphabet City, also die Avenues A, B, C und D oberhalb des East River, wo die Stadt in einem Anfall von Großherzigkeit, wie er hier manchmal vorkommt, ein Housing Project in Form von kostenlosen Wohnblocks für die Ärmsten realisierte. Diese verwandelten sich, den Naturgesetzen folgend, sogleich in ein Zentrum der Drogensucht und der Prostitution. Ich weiß, dass ich zwischendurch auch noch woanders wohnte, denn ich kann mich dunkel an etwas an der Ecke Broadway und Elfte Straße erinnern und an etwas in Soho. Wohnungen, in denen ich weniger als zwei Wochen verbrachte, zähle ich gar nicht erst mit. Na, und zu guter Letzt die West End Avenue, also die Upper West Side oberhalb des Hudson River. Also Türsteher in Uniformen und überhaupt alles vom Feinsten.
New York begann für mich ziemlich gut, denn meine Benningtoner Studentinnen und Studenten waren wegen der Semesterferien in der Stadt, und ich kam für einige Zeit bei ihnen unter. Ich planschte in einem Jacuzzi oberhalb der Park Avenue, und das blaue Wasser der Toilettenspülung strudelte ebenso sanft, wie sich Sartres und Susan Sontags Ansichten zum Kommunismus änderten. Ich rief all meine Freunde an, und jene von ihnen, die sich noch nicht über meine Situation im Klaren waren, bewiesen mir ihre große Zuneigung und ihr Vertrauen, indem sie mich anpumpten. Doch schon bald kehrten die Studenten zur Uni zurück, und ich kam nicht umhin, eine gewisse Beobachtung zu beobachten, wie sich vor Jahren der Chefredakteur einer bedeutenden Warschauer Wochenzeitschrift ausdrückte, dass nämlich, wenn auch New York mit Sicherheit das gelobte Land ist, so doch nicht zwangsläufig für jeden. Der Held eines Romans von Scholem Alejchem preist New York voller Begeisterung mit den Worten: "Du setzt dich einfach irgendwo hin, und neben dir sitzt vielleicht der Präsident, ein Stück weiter ein armer Schlucker, ein Bettler oder eine komplette Null. Und noch weiter ein Graf, ein Magnat, ein Millionär. Das ist Zivilisation, Fortschritt, Kolumbus."
„Wenn das so ein glückliches Land ist, wo alle gleich sind“, bemerkt nicht zu unrecht sein Gegenüber, „wieso gibt es dann dort Habenichtse und Fürsten, Bettler und Magnaten? Entweder, oder.“
Aus dem Polnischen von Heinz Rosenau
Copyright © by Janusz Głowacki, 2004
Copyright © by Bertelsmann Media Sp. z o.o., 2004
Die drei Kurzerzählungen (N.Y.C.; Greenpoint; Za duże miasto) sind dem Band »Z głowy«, Warszawa 2004, entnommen.
Artikel erschienen erstmals auf Deutsch im Jahrbuch Polen 2010 Migration, Wiesbaden 2010.
Dank an das Deutsche Polen Institut Darmstadt.

